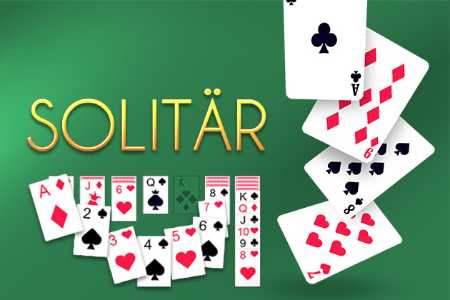Linnemann verspricht bei Illner "Politikwechsel" - und sieht sich "zum Erfolg verdammt"

Am Mittwochnachmittag haben Union und SPD ihren Koalitionsvertrag präsentiert. Er bietet viele Wahlgeschenke, doch einiges bleibt eher im Ungefähren und soll erstmal in Kommissionen beraten werden. Trotzdem müsse jetzt alles sehr schnell gehen, sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann am Donnerstagabend in der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner". "Der Politikwechsel steht in dem Koalitionsvertrag", betonte er. So werde die illegale Migration gestoppt, die Wirtschaft gefördert und Bürokratie abgebaut. "Aber ich sage Ihnen auch ganz klar: Das muss jetzt umgesetzt werden."
Linnemann, der ein Kandidat für das Amt des Wirtschaftsministers ist, glaubt an den Erfolg der neuen Bundesregierung. "Ich bin der festen Überzeugung, dass wir das packen", so Linnemann. Die Regierung werde mit einem Sofortprogramm beginnen. "Bis Juli müssen die wichtigsten Pflöcke eingesetzt werden", wusste Linnemann. Er geht davon aus, dass der neue Bundeskanzler am 6. Mai gewählt wird. "Die Bundesregierung wird dann sehr schnell stehen, und dann haben wir zehn Wochen Zeit, um sofort die wichtigsten Punkte abzuarbeiten, damit es auch schon in der Sommerpause eine andere Grundstimmung in Deutschland gibt."
Linnemann weiter: "Daran werden wir uns messen lassen müssen." Auch die Folgen eines Scheiterns sind ihm bewusst: Wenn sich nicht alle Kräfte dem Ziel "Politikwechsel" unterordnen würden, werde man in zwei, drei Jahren Populisten mit Regierungsstärke sehen. "Wir müssen liefern. Wir sind zum Erfolg verdammt."
Manuela Schwesig: "Die Menschen haben die Nase voll von Streit"
Dennoch: Es gibt auch Kritik an dem Vertragswerk. Der Chef des Arbeitgeberverbandes für die Metallindustrie, Stefan Wolf, hätte sich noch mehr Steuererleichterungen für die Wirtschaft gewünscht. Wie viele Experten ist er gegen die Erhöhung der Mütterrente, die so gering sei, dass es die Empfängerinnen gar nicht merken würden, sagte er. Und er forderte: "Wir brauchen eine Deckelung der Sozialversicherungsbeiträge bei 40 Prozent. Das müssen Sie dringend angehen."
Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, hat den Koalitionsvertrag mit ausgehandelt. Sie forderte von der neuen Regierung vor allem eines: nicht so viel Streit wie in der Ampelkoalition. Denn davon habe die Bevölkerung genug. "Sie haben die Nase voll von Streit. Die Leute wollen einfach nur noch wissen, welche Antworten es auf die Probleme gibt, wie die Wirtschaft wieder stärker und die Arbeitsplätze sicherer werden."
Die Menschen würden zudem mehr günstigen Wohnraum und eine gute Gesundheitspflege fordern. Klar sei schon: Die Regierung werde massiv in die Infrastruktur, die Wirtschaft und den sozialen Wohnungsbau investieren. Dazu diene das Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für die nächsten zwölf Jahre. Schwesig: "Es steckt ganz viel in dem Vertrag. Wenn wir es schaffen, schon mal die Hälfte umzusetzen, dann wird es dem Land besser gehen." Nicht alle Forderungen der Sozialdemokraten fänden sich jedoch im neuen Koalitionsvertrag wieder. So habe die SPD die von ihr geplante Reichensteuer nicht durchsetzen können.
Schwesig blickt in die Zukunft: "Das ist eine Mega-Herausforderung"
Dafür verspricht der Vertrag aber fast jedem Erleichterungen: Demnach wird das Bürgergeld abgeschafft und durch eine neue Grundsicherung ersetzt, es gibt Superabschreibungen für die Wirtschaft, eine neue Körperschaftssteuer ab 2028. Strompreise und Netzentgelte gehen runter, die Gasumlage fällt ganz, energieintensive Unternehmen sollen einen niedrigeren Industriestrompreis zahlen. Rentner, die weiter arbeiten, sollen Steuerbefreiungen bekommen. Das Rentenniveau von 48 Prozent bleibt erst einmal, ist aber nur bis 2031 gesichert. Die Mütterrente wird erhöht, der Agrardiesel wird subventioniert. Die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wird gesenkt.
Und das alles in einer Zeit, in der die Wirtschaft in Deutschland schrumpft und der amerikanische Präsident Trump die Welt mit seiner Zollpolitik in Atem hält. Die Modelle der letzten Jahrzehnte funktionieren nicht mehr, argumentierte Schwesig. Es gebe keine billige Energie mehr aus Russland und keine billige Sicherheit mehr durch die USA. "Wir müssen das jetzt selber machen", so Schwesig. Man müsse den Menschen klar sagen: "Das ist eine Mega-Herausforderung."