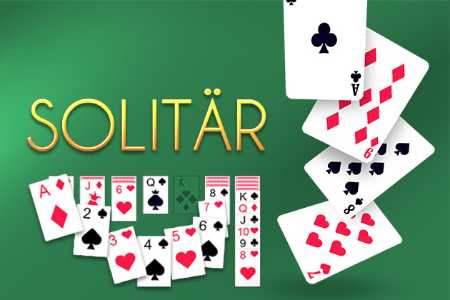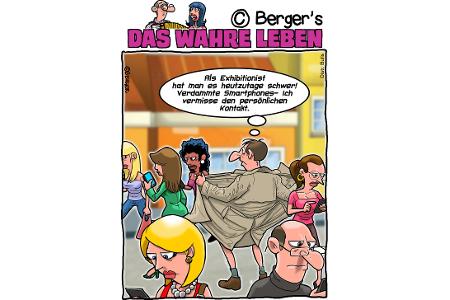Castingshows: "Die Abwertung wirkt massiv"

Barbara Strohschein untersucht in ihrem Buch "Die gekränkte Gesellschaft" ein Phänomen, das wir täglich beobachten: die Erfahrung der Entwertung. Im Interview spricht sie über Castingshows, den Blick in den Spiegel und darüber, was jeder einzelne tun kann.
Barbara Strohschein hat erforscht, wie Entwertung den Menschen zu schaffen macht: in der Familie, in Bezug auf den Körper, beim Sex und in vielen anderen Bereichen. Ihre Ergebnisse präsentiert sie in dem Buch "Die gekränkte Gesellschaft: Das Leiden an Entwertung und das Glück durch Anerkennung" (Riemann Verlag, 416 Seiten, 17,99 Euro). Im Interview mit spot on news erzählt die promovierte Philosophin, was Castingshows mit Menschen machen und wie jeder einzelne von uns etwas ändern kann.
Mehr zum Thema Castingshows gibt es auf MyVideo
In Ihrem Buch "Die gekränkte Gesellschaft" setzen Sie sich mit Entwertungen auseinander.
Barbara Strohschein: Dieses Thema ist für viele schwer auszuhalten, andererseits ist die Auseinandersetzung damit sehr wichtig. Wenn wir nicht hinsehen und etwas nicht erkennen, können wir auch nichts verändern. Ich sehe mein Buch zudem als ein großes Ermutigungsbuch. Meine Botschaft ist: Lasst euch nichts gefallen! Macht Euch auf den Weg, um selbstbestimmt und selbstbewusst zu leben. Lasst euch dieses pausenlose Bewerten vom Arbeitgeber, von Jurys, Eltern, Lehrern etc. nur begrenzt gefallen. Sucht nach euren eigenen Werten und macht euch diese bewusst.
Apropos Jurys: Im Fernsehen gibt es viele Formate, zum Beispiel Castingshows, die fragwürdige Werte präsentieren. Warum schauen sich die Zuschauer das trotzdem so gerne an?
Strohschein: Ich vermute, dass sie in den Personen, die darin auftreten, Projektionsfiguren sehen, an deren Stelle sie eigentlich sein möchten. Viele Zuschauer denken, durch so einen Auftritt im Fernsehen würde der Selbstwert gesteigert werden.
Die Kandidaten werden aber auch häufig negativ bewertet...
Strohschein: Leider ist das so. Die Entwertung, die in diesen Shows stattfindet, ist gravierend. Mich wundert, dass die Menschen dagegen nicht aufbegehren. Die Gründe dafür schildere ich in meinem Buch. Der Wunsch, etwas wert zu sein durch den Auftritt im Fernsehen ist größer als der Impuls, gegen die Entwertung zu kämpfen. Die Abwertung kommt oftmals gar nicht so ins Bewusstsein, wirkt aber trotzdem massiv.
Wäre unsere Welt ohne diese Shows ein Stück besser?
Strohschein: Zumindest sollten sich die Beteiligten überlegen, was sie da untereinander und miteinander anstellen. Wie kommt eine Jury dazu, den Körper eines jungen Menschen zu beurteilen, wie kommen Jugendliche dazu, sich so zu präsentieren und vernichtenden Urteilen auszusetzen? Und die Eltern machen diese Spiele mit und überlegen gar nicht, was sie den Kindern damit antun. Sie denken nicht genug darüber nach, dass die Kinder irgendwann durchfallen und nicht mehr beachtet werden, nachdem sie so gehypt worden sind. Solche Erfahrungen heben das Selbstwertgefühl überhaupt nicht.
Auch die Erwachsenen unterwerfen sich häufig gängigen Schönheitsidealen. Was macht das mit unserer Gesellschaft, wenn sich viele Menschen nach dem Blick in den Spiegel als zu unattraktiv oder nicht hipp genug empfinden?
Strohschein: Diese Schönheitsbilder entsprechen Idealen, die fast unerreichbar sind. Oder nur mit furchtbar viel Aufwand an Energie, Zeit und Geld. Und man muss sich fragen, woher diese Fokussierung auf perfektes Aussehen kommt. Andere Qualitäten wie Verlässlichkeit, Fleiß, Kreativität, soziales Engagement scheinen viel weniger wichtig zu sein als perfektes Aussehen. Dabei sind diese anderen Qualitäten letztendlich doch viel viel wichtiger.
Ist das ein Problem unserer modernen Zeit oder gab es das schon immer?
Strohschein: Diese Fokussierung auf einen schönen, schlanken Körper hat es in dieser radikalen Form noch nie gegeben. Durch die Leib-Feindlichkeit des Christentums hat man in Europa auf körperliche Attraktivität lange keinen Wert gelegt. Im antiken Griechenland gab es aber schon ein Schönheitsideal: ein schöner Geist wohnt in einem schönen Körper - das ist eine philosophische Implikation, die natürlich ihre Berechtigung hat. Ich bin unbedingt dafür, dass Menschen ihren Körper lieben und pflegen, aber nicht einem Ideal hinterher jagen, das eher krank macht.
Sie nehmen in Ihrem Buch auch die Themen Partnerschaft und Sexualität unter die Lupe. Müssen wir uns hier von unseren gängigen Vorstellungen verabschieden?
Strohschein: Das wäre sehr hilfreich. Wir sollten uns überlegen, was Sexualität, Partnerschaft und Liebe für das eigene Selbstwertgefühl bedeuten. Wenn Männer verstehen, dass sie Frauen brauchen, um Männer zu werden und umgekehrt - was nicht ausschließt, dass Frauen mit Frauen und Männer mit Männern glücklich werden können - dann hätten wir diese Feindseligkeit, die zwischen den Geschlechtern vorherrscht, reduziert. Männer fühlen sich abgewertet, wenn Frauen sich sexuell verweigern oder sie als Chauvis und Versager hinstellen. So kann es keinen Frieden geben. Die Männer mussten sich auch daran gewöhnen, dass Frauen intelligent und selbstbestimmt sein wollen und nicht nur dafür da sind, Mutter, Hausfrau und Ehefrau zu sein.
Sie stellen auch Projekte von Menschen vor, die die Probleme anpacken. Haben Sie Tipps, wie jeder einzelne von uns etwas ändern kann?
Strohschein: Ich mache die Erfahrung durchweg, dass Menschen, die sich engagieren - ehrenamtlich oder in anderen Zusammenhängen, die ihnen Freude machen - ganz viel Selbstwert erfahren. Das bedeutet: Wenn ich mich engagiere, erkennen das andere Menschen an, freuen sich darüber und geben mir positives Feedback. Neben diesem Engagement finde ich es auch wichtig, Gemeinschaft zu leben, nicht nur in der Beziehung zu dem Partner oder in der Familie zu bleiben, sondern den Blickwinkel für die Vielfalt von Beziehungen zu öffnen. Wichtig ist, dass man sich austauscht, zusammenhält und nicht in isolierten, kleinen Kontexten bleibt. Wir wachsen durch Beziehungen und nicht nur durch Zweier-Beziehungen, sondern durch und in Gemeinschaften.