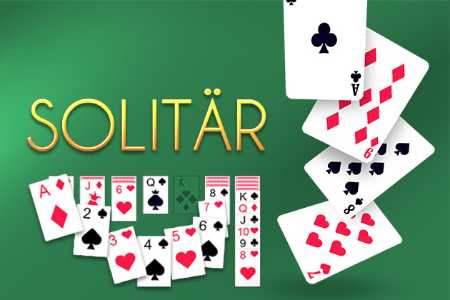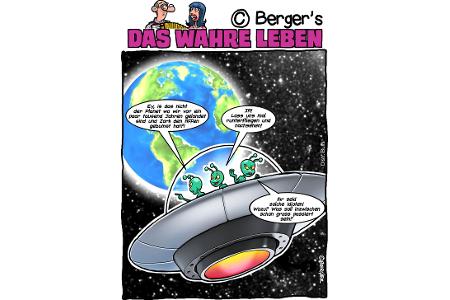"Hannas Reise": Vom "Sühne-Sex" in Tel Aviv und Berlin

Rund drei Millionen Zuschauer verfolgten gestern die deutsch-israelische Liebeskomödie "Hannas Reise" im TV. Ein Film, der spielerisch mit den Tabus bricht. Warum der "unverkrampfte Umgang mit schweren Themen" so wichtig ist, erklärt Hauptdarstellerin Karoline Schuch und blickt im Interview auf die Dreharbeiten in Tel Aviv zurück.
"Jude und behindert zählt doppelt", ein unangenehmer Satz, der aber offenbar seine Berechtigung hat, wie die Liebeskomödie "Hannas Reise" am Mittwochabend im Ersten zeigte. "Das ist ein furchtbarer Satz, aber in dem Kontext stimmt er einfach", findet auch Hauptdarstellerin Karoline Schuch (33, "Mann tut was Mann kann"). Rund drei Millionen Zuschauer verfolgten gestern die Liebesgeschichte zwischen der deutschen Studentin Hanna (Schuch) und dem attraktiven Israeli Itay (Doron Amit). Der Film breche mit ein paar Tabus, erklärt Schuch weiter. Die Folge sei, dass man die Themen wieder lebendig diskutieren könne - zumindest wünsche sie sich das.
"Hannas Reise": Bei MyVideo können Sie den Trailer zum Film ansehen
Ein anderer provokanter Begriff im Film, ist der sogenannte "Sühne-Sex". Ob der Umgang der jungen Menschen miteinander in Tel Aviv, wo der Film gedreht worden ist, tatsächlich davon geprägt war, erklärte Schuch so: "Erlebt habe ich das nicht." Nicht zu leugnen sei aber, "dass die Israelis extrem auf blonde Frauen stehen, umgekehrt finden die Deutschen aber auch Israelis total heiß". Ferner gebe es eine große Anziehungskraft zwischen Berlin und Tel Aviv. "Und ich finde es sehr schön, dass das wieder möglich ist", so die gebürtige Thüringerin weiter. Das "Hannas Reise" so unverkrampft mit den schweren Themen umgeht, habe auch sie selbst "total befreit".
So waren die Dreharbeiten in Israel
Viele verbinden mit Israel die ständige Bedrohung durch Bomben. Nicht unrealistisch, wie Schuch meint: "Während der letzten Drehtage sind Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert worden. Ich habe vier Luftangriffe miterlebt und das muss ich in meinem ganzen Leben nicht mehr haben." Es sei keine schöne Erfahrung gewesen. Kalt lässt das auch die Einheimischen nicht. "Während der 30 Sekunden, die du Zeit hast vom Alarm bis zum Einschlag der Bombe, habe ich keine entspannten Leute gesehen." Die Reaktion überrascht dann aber doch:
Sobald der Knall einer Bombe zu hören ist, "schauen alle auf ihr Handy, wo es war, und wenn sie dort niemanden kennen, gehen sie wieder ganz normal ihrem Tagesgeschäft nach". Doch es gibt offenbar auch viele schöne Seiten: "Grundsätzlich ist das Wetter schon ziemlich toll, der Stadtstrand [Tel Aviv] ist auch super und wenn du dann in der Mittagspause mal schnell ans Meer kannst, ist das schon sehr schön", schwärmt sie.
Der Holocaust und die nicht-involvierte Generation
Auch Schuch entstammt einer Generation, die nicht direkt in den Holocaust involviert war. Oft heißt es dann, dass man ja nicht für immer büßen könne. "Eine Schwierigkeit ist sicher, dass alle, die älter sind oder sich sehr gut auskennen, so eloquent darüber reden, dass man denkt, nicht mehr wirklich etwas beisteuern zu können", beschreibt Schuch die grundlegende Problematik.
Die verständliche Folge sei, dass man dann so eine Art Schutzmauer und ein "Lasst mich damit in Ruhe!" um sich herum aufbaue. Es gehe aber gar nicht unbedingt darum, dass wir nichts damit zu tun hatten, findet die Schauspielerin. "Man hat mehr damit zu tun, als einem lieb ist, aus dem einfachen Grund, weil man Deutscher ist."