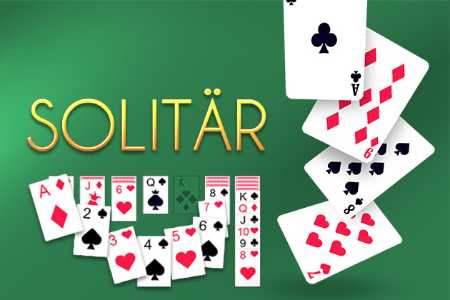Jörg Hartmann: "In unserem Land wird zu viel gemeckert"

Die vierte Staffel "Weissensee" steigt im Frühjahr 1990 in die Handlung ein - ein neues Zeitalter für Deutschland. Welche Bilanz Schauspieler Jörg Hartmann 28 Jahre später über die deutsche Wiedervereinigung zieht und was ihm am heutigen Deutschland besonders stört, verrät der "Weissensee"-Star im Interview.
Wenn die Erfolgsserie "Weissensee" mit sechs neuen Folgen (ab Dienstag, 8. Mai um 20:15 Uhr in Doppelfolgen, das Erste) in die vierte Staffel geht, hat sich für die Familie Kupfer mit dem Fall der Mauer einiges geändert. Insbesondere für Falk, der seit seiner Schussverletzung im Rollstuhl sitzt und unter falschem Nachnamen bei einem West-Konzern angeheuert hat. Sein Darsteller Jörg Hartmann (48, "Das Ende einer Nacht") hat mit der Nachrichtenagentur spot on news über die Herausforderung gesprochen, eine Querschnittslähmung zu spielen, und über sein Fazit nach knapp drei Jahrzehnten Wiedervereinigung.
Die DDR ist Geschichte, Ihre Rolle lebt unter neuem Namen und blickt in eine Zukunft im Rollstuhl: Erleben wir in Staffel vier einen geläuterten Falk Kupfer?
Jörg Hartmann: Auf jeden Fall erleben wir einen Falk Kupfer, der auf Grund seiner (inkompletten) Querschnittslähmung auf sich und seinen Körper zurückgeworfen wird, der nun gezwungenermaßen viel Zeit zum Nachdenken und zur Reflexion hat. Aus dem Saulus Falk wird kein Paulus, aber vor allem die Liebe zu Petra, die im Frauengefängnis Hoheneck einsaß, lässt ihn zwar nicht an seinem Traum vom Kommunismus zweifeln, wohl aber an den Mitteln, die er auf dem Weg dahin gewählt hat.
Die Vergangenheit holt Falk schließlich doch ein. Verdient er nach allem, was er getan hat, überhaupt einen Neuanfang?
Hartmann: Jeder verdient einen Neuanfang, wenn er ernsthaft bereit ist, sich mit seinen Fehlern und seiner Schuld auseinanderzusetzen.
Wie groß war die Herausforderung, eine Querschnittslähmung zu spielen?
Hartmann: Der Respekt gerade vor den Szenen am Barren in der Physiotherapie wuchs mit jedem Besuch im Reha-Zentrum. Jede Begegnung mit den beiden Querschnittsgelähmten, die bereit waren, mir bei der Vorbereitung zu helfen, vergrößerte die Bewunderung für sie und ihre Leistung. Je mehr ich erfuhr über die wirklichen Bewegungsabläufe bei dieser Art der Querschnittslähmung, desto schwerer erschien es mir, das wirklich wahrhaftig zu spielen. Letztendlich sind die Therapie-Szenen nur ein kleiner Teil der Geschichte, aber sie erforderten die meiste Vorbereitung. Ich war jedes Mal dankbar, dass ich nach Drehschluss den Rollstuhl wieder verlassen konnte. Hochachtung für alle, die dieses Schicksal meistern und ihre Lebensfreude nicht verlieren!
Sie sind im Westen aufgewachsen. Was haben Sie damals von der DDR und dem Leben dort mitbekommen?
Hartmann: Kaum etwas. Ich war vor dem Mauerfall nur zweimal kurz in Ost-Berlin. Wir hatten weder Verwandtschaft noch Freunde in der DDR. Erst kurz vor der Wende entstand eine Freundschaft zu einer Familie aus Jena, die ich aber erst im März 1990 dort besuchte, also genau in der Zeit, in der die vierte Staffel beginnt. Kurz zuvor, im Januar 1990, stand plötzlich ein junges Paar aus Zwickau, das wir noch vor der Maueröffnung in Ungarn kennengelernt hatten, vor unserer Tür und wollte bleiben. Die Beiden leben noch heute in Herdecke.
Was war Ihr spannendstes Erlebnis bei Ihren Besuchen im Osten vor dem Mauerfall?
Hartmann: Ich war nur zweimal in Ost-Berlin, das war alles. Einmal 1984, da waren der Deutsche und der Französische Dom am heutigen Gendarmenmarkt noch Ruinen, aus denen Bäume wuchsen. Wenige Jahre später war ich nochmal mit dem Handball-Verein dort. Ich erinnere mich an eine Gruppe Jugendlicher am "Tränenpalast", mit denen wir ins Gespräch kamen und die dortbleiben mussten, während wir wieder in die S-Bahn nach West-Berlin einsteigen durften. Die Perversion eines Systems, das seine Menschen einsperrt, war für mich in diesem Moment mit Händen zu greifen.
Welches Fazit ziehen Sie nach knapp drei Jahrzehnten Wiedervereinigung zum Zusammenwachsen zwischen Ost und West?
Hartmann: Als Wahl-Potsdamer ist die Wiedervereinigung sowieso etwas ganz Selbstverständliches für mich. Anderen Menschen mag es anders gehen, und immer wieder macht es mich traurig, wenn Menschen den jeweils anderen Teil Deutschlands noch nie besucht haben oder gar aus Desinteresse und Vorurteilen einen Besuch entschieden verweigern. Aber mir bereitet viel eher Sorge, dass der Ton in der Gesellschaft allgemein ein rauerer geworden ist, dass die Menschen mehr übereinander als miteinander reden, dass die Regeln eines respektvollen Miteinanders immer schneller über Bord geworfen werden. Generell wird zu viel gemeckert in unserem Land, und da schließe ich mich nicht aus, aber das soll jetzt anders werden! (lacht)
Sie feiern nicht nur mit "Weissensee", sondern auch mit dem "Tatort" große Erfolge. Wie hat sich Rick Okon alias Jan Pawlak ins Dortmunder "Tatort"-Team eingefügt, und was ändert sich durch die neue Personalie für Ihre Rolle von Hauptkommissar Faber?
Hartmann: Rick ist ein klasse Kollege und Mensch, ein begabter junger Schauspieler mit den geradezu klassischen Manieren eines Gentlemans, eine Freude und ein Gewinn für uns. Für Faber bedeutet der neue Kollege auf jeden Fall weniger Streit.